
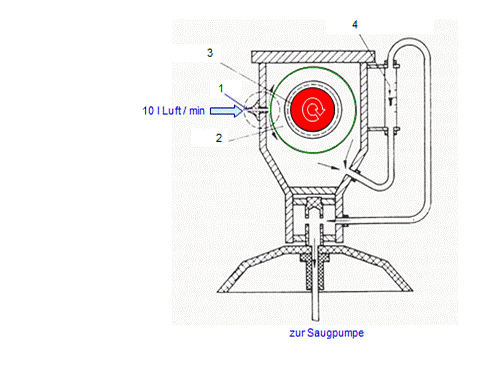
Wie werden windverwehte Pollen und Sporen gefangen (Probenahme)?
Mit Hilfe einer Pumpe (s.u.: Probenahmegerät) werden im Dauerbetrieb (rund um die Uhr) pro Minute 10 Liter Luft durch den Ansaugschlitz bzw.-schacht eines international verwendeten Geräts (BURKARD Pollen- und Sporenfalle) gesaugt und auf einen klebrigen Folienstreifen gelenkt; dort schlagen sich Partikel im Größenbereich von ca. 1 bis 100 Mikrometer nieder. Da die Folie hinter dem Ansaugschlitz kontinuierlich vorbeiwandert (2mm pro Stunde), ist eine zeitliche Auflösung bei der mikroskopischen Auswertung möglich. Wann genau ein bestimmtes Pollenkorn auf die Fangfolie aufschlägt, lässt sich nicht auf die Minute genau bestimmen. Denn der (14 mm breite) Ansaugschacht ist 2 mm hoch: die möglichen Aufschlagpunkte auf der hinter dem Schacht befindlichen Fangfolie verteilen sich also - der Vorschubgeschwindigkeit der Fangfolie entsprechend - über eine Zeitstrecke bzw. ein Zeitfenster von 60 Minuten.
Parallel zur Bestimmung des Pollen- und Sporengehalts der Luft werden an den Messstellen Delmenhorst und Ganderkesee durch eine elektronische Wetterstation wichtige meteorologische Parameter wie Temperatur, relative Luftfeuchte, Luftdruck, Windwerte und Niederschlag gemessen. Für die anderen Messstellen werden Fremddaten genutzt.
Details zur Pollenfalle
Das Probenahmegerät - die "Pollenfalle"

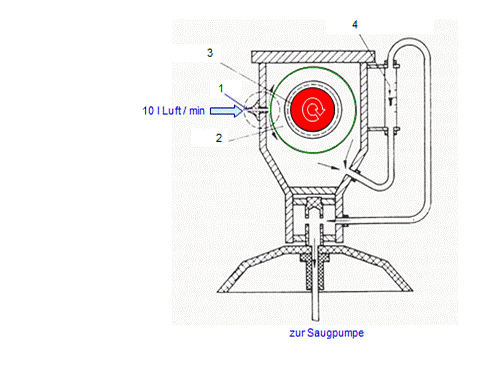
Bild A
links:Werkstattbild einer BURKARD Pollen- und Sporenfalle
rechts: Schematischer Längsschnitt : Nicht dargestellt sind Windfahne, Regendach, Spannbügel und Saugpumpe; der angebaute Durchflussmesser ist optional.
1 Ansaugschlitz
2 Fangtrommel
am Uhrwerk im Fallentopf
3 Uhrwerk
am herausziehbaren Deckel des Fallentopfs
4 Durchflussmesser
(nur bei älteren Modellen angebaut, ansonsten als mobiles Zubehör verfügbar)
Die im Schema (rechts) ist die Windfahne nicht eingezeichnet: sie sorgt für die unerlässliche Ausrichtung des Ansaugschachts in den Wind.
Maße des Ansaugschachts (seitlich am Fallentopf)
-
Ansaugöffnung: 2 mm (Höhe) × 14 mm
(Breite)
-
Tiefe des Ansaugschachts: 19 mm bis 21 mm
Am abnehmbaren und mit einem Bügel arretierten Deckel ist die Funktionseinheit aus
Uhrwerk (3) und Fangtrommel
Das Uhrwerk dreht die
aufgesetzte Fangtrommel
(Es gibt auch Uhrwerke mit einer Drehgeschwindigkeit von 360° pro Tag; damit kann man den Pollenkonzentrationsverlauf über den Tag hinweg genauer erfassen))
Die Fangtrommel (Probenahmetrommel, Bild B und Bild C): flacher
Zylinder mit einem Durchmesser von 10,9 cm und demgemäß
einem Umfang von 34,5 cm. Auf diese Trommel mit einer ausgefrästen Laufflächenbreite von ca. 20 mm wird eine
19 mm breite Folie aufgezogen. Diese Fangfolie ist mit einem Adhäsiv (z.B.
Vaseline., im Mittelmeerraum: Silikon)
beschichtet.
Die Funktionseinheit aus Fallentopfdeckel, Uhrwerk und Fangtrommel wird über eine Führungsschiene in den Sammeltopf eingeschoben. Trommeloberfläche (ohne Folie) hat dann einen Abstand vom Innenrand des Ansaugschlitzes von nur etwa 0,7 mm.
Eine Pumpe saugt die (pollen- und sporenhaltige) Luft über
den Ansaugschlitz an.
Eine Windfahne dreht die Ansaugöffnung in den Wind .
Eine Regenschutzdach soll das Eindringen von Regenwasser in
den Ansaugschlitz verhindern.
An Spannbügel dienst zur
Arretierung des Deckels.
Mit einem in Bild A über dem Typenschild erkennbaren Blockierbolzen läss sich der im Betrieb windbewegte Fallentopf arretieren, um den Trommelwechsel ungestört durchführen zu können.
Ein Dreibein dient zur Befestigung des Sammelgeräts auf einem Messgeräteturm oder einer anderen Montagefläche.
Zubehör
·
Trommelständer
mit Rändelmutter zur Aufnahme der Fangtrommel für die Präparation vor und nach
der Exposition
·
Zweit- bzw. Ersatztrommel zum Austausch beim
Trommelwechsel
·
Präpariernadel o.ä. zum Markieren der Fangfolie
durch den Ansaugschlitz hindurch (Trommel im Gerät)
·
Mechanisches Ersatzuhrwerk und Schlüssel zum
Aufziehen
·
Durchflussmesser (Rotameter, engl. flow meter)
zur Kontrolle des Ansaugvolumens (10 l/min)
Damit sich auf der Fangfolie die gewünschten Partikel
(Pollen und Sporen) niederschlagen können und haften bleiben, muss diese mit
einem Adhäsiv (Haftmittel oder Haftmedium) beschichtet werden. Fangfolie und
Adhäsiv müssen so beschaffen sein, dass eine mikroskopische Auswertung erfolgen
kann, das heißt sie müssen homogen, transparent, wasser-, luftfeuchte- und
hitzebeständig sein.
Die Fangfolie wird auf der Fangtrommel fixiert. Die
Beprobungsdauer bestimmt die erforderliche Transportgeschwindigkeit der Folie:
Bei einer kontinuierlichen Beprobung über beispielsweise sieben Tage ergeben
sich 2 mm/h, was einer Gesamtfolienlänge von 336 mm entspricht.
Im nördlichen Europa einschließlich Deutschland wird
vorwiegend Vaseline als Adhäsiv eingesetzt, in den Ländern Südeuropas
Silikon(öl).
·
Silikonöl ist temperaturstabil (-20°C bis 150°C),
ändert also seine Viskosität in diesem Temperaturbereich nicht. Es wird in
gelöster Form auf die Fangfolie aufgetragen, um eine gleichmäßige Beschichtung
zu ermöglichen.
Wichtiger
Hinweis
Die verwendeten Lösungsmittel sind toxisch. Dies erfordert das Arbeiten unter
einem Abzug.
Mit Silikonöl gebrauchsfertig
beschichtete MELINEX®folien[1] sind
kostenintensiv. Aufgrund der im Vergleich zu Vaseline geringeren Adhäsivität des
Silikonöls bleiben insbesondere größere Pollen mit größerer Wahrscheinlichkeit
erst gar nicht haften oder werden bei der Einbettung leichter in Randbereiche
verschwemmt.
·
Vaseline (ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffen) wird
mit zunehmender Temperatur flüssig (Schmelzbereich 38°C bis 60°C). Ab Werten
über 25°C wird die Auswertung u.U. durch Streifenbildung erschwert.
Die verwendeten Adhäsive sind unterschiedlich „klebrig“, was eine unterschiedliche Sammeleffizienz bedingt
Der obere Teil des Probenahmegeräts („Fallentopf“ mit
„Deckel“) ist drehbar gelagert und mit einer Windfahne ausgestattet. Die Fahne
sorgt dafür, dass der Ansaugschlitz in den Wind dreht.
Wesentlich für die Abscheidung von Partikeln aus der Luft
auf die Fangfolie im Fallentopf ist der durch eine Ansaugeinheit bewirkte
Einstrom von Luft (10 l/min) durch den Ansaugschlitz und -schacht. Um eine
zeitliche Auflösung der Probenahme zu ermöglichen, wird die Fangfolie durch
Drehung der Trommel hinter dem Ansaugschlitz mit kontinuierlicher
Geschwindigkeit (2 mm/h) vorbeibewegt.
Der geringe Abstand der Fangfolie vom Innenrand des
Ansaugschachtes bedingt eine nahezu
rechtwinkelige Ablenkung des Luftstroms. Dieser abrupten Änderung der
Strömungsrichtung kann ein Teil der Pollen und Sporen nicht folgen (je größer
die Partikel, umso weniger gut). Dies bedingt die Impaktion der Partikel auf
der mit einem Adhäsiv beschichteten Folie.
Stationäre Probenahmegeräte unterliegen einer
grundsätzlichen Einschränkung: Sie beproben die Luft jeweils an einem
bestimmten Punkt. Die durch mikroskopische Auswertung der Luftstaubproben
ermittelten Messwerte (Konzentrationsangaben) beschreiben damit primär eine punktuelle
Belastung mit allergenen Partikeln. Sie dürfen daher streng genommen nicht auf
die Umgebung des Probenahmegeräts mit ihrer in der Regel ungleichen Verteilung
von Allergenquellen übertragen werden. Eine räumliche Repräsentanz des Probenahmegeräts
im Sinne einer Mengen-Repräsentanz ist damit prinzipiell nicht gegeben.
Wird ein möglichst großer Abstand zu den nächstgelegenen
Pollenquellen eingehalten, so beschreiben die Messwerte eher die im jeweiligen
Zeitraum untere Grenze der Konzentration im Einsatzbereich des Probenahmegeräts.
Dieser Einsatzbereich (= „Repräsentanzbereich“) lässt sich über Klimadaten oder
phänologisch über Blühphasendaten eingrenzen oder zumindest abschätzen.
Je geringer die Schwankungen in der Höhenlage und je
gleichförmiger die Art der Landnutzung (Bebauung, Landwirtschaft, Wald) im
Umkreis des Probenahmegeräts ist, umso größer ist der „phänologische“ Repräsentanzbereich.
Der Probenahmestandort muss durch geographische Koordinaten (geographische Breite und geographische Länge) und durch Höhenangaben (Höhe über dem mittleren Meeresspiegel = Mean Sea Level, Höhe über Grund = Above Ground Level (AGL) und Höhe über Montagefläche, z.B. Flachdach) beschreiben werden.
Anzugeben ist auch die Höhe vom Straßenniveau bzw. Montageniveau bis zum
Ansaugschacht des Probenahmegeräts.
Für die Erfassung von Pollen und Sporen in bebauter Umgebung
bietet sich die Montage des Sammelgeräts auf Flachdächern an. Mit zunehmender Höhe
über Grund (AGL) verringert sich der Einfluss nahe gelegener bodennaher Quellen
(Gräser und andere Kräuter). Da es an Dachkanten im Bereich sonnenbeschienener
Fassaden zu Turbulenzen kommen kann, ist ein Mindestabstand des
Probenahmegeräts zur Dachkante von > 2 m einzuhalten.
Es gibt aber auch Fragestellungen, die eine bodennahe
Aufstellung des Probenahmegeräts erforderlich machen können.
Das Probenahmegerät muss von allen Seiten frei anströmbar
sein. Zu feststehenden Hindernissen ist ein seitlicher Abstand von mindestens 1
m, zu Bewuchs von etwa der halben Bewuchshöhe einzuhalten [VDI 2119]. Empfohlen
wird ein Abstand zu Gebäuden, Gebäudeteilen und Bäumen von 2 × Höhe des Objekts
(die Höhe des abschirmenden Objekts ergibt sich aus der Differenz Höhe Objekt
und Höhe Ansaugöffnung). Außerdem sollte das Probenahmegerät keinen Emissionen
unmittelbar benachbarter oder vorübergehender Quellen ausgesetzt sein, die die
gewünschte Repräsentanz der Messung stören können (VDI 4280 Blatt 1).
Detailliertere Informationen zur Standortwahl können der VDI 4280 Blatt 1
entnommen werden.
Die Standortgegebenheiten und deren Änderungen im Laufe der Jahre müssen dokumentiert werden. Dazu eignen sich fotographische Aufnahmen, Luftbildaufnahmen und Kartierungen der Vegetation im Umkreis des Probenahmegeräts.
Da das Wetter (z.B. Windgeschwindigkeit und -richtung,
Temperatur, Niederschlag) einen unbestreitbaren Einfluss auf den Pollen- und
Sporenflug hat, ist es hilfreich, auf ortsnahe meteorologische Messwerte zurückgreifen
zu können.
Aufgrund kleinräumlicher Gegebenheiten (z.B. Vegetation, Verkehrsdichte, Bebauung) kann sich die Pollenanzahl an verschiedenen Messorten deutlich unterscheiden. Es ist daher empfehlenswert, für die Raumrepräsentanz den Pollenflug an mehreren Stellen zu erfassen.
Details für das Messstellenpersonal:
Stand: 17.02.2022
Copyright (c) R. Wachter. Alle Rechte
vorbehalten.
wachter@pollenflug-nord.de